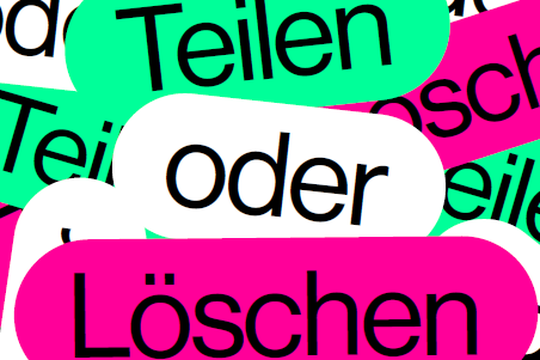Was die Erfindung der Schrift und Soziale Medien gemeinsam haben?
Am 24. Oktober fand in der Garage 8 in Olten eine weitere Ausgabe des Facts or Fiction-Anlasses statt. Zusammen mit der Arbeitsgruppe Junge gestaltete die SRG Aargau Solothurn einen Abend, der sich auf unterhaltsame und jugendfreundliche Weise der Frage widmete: «Was ist zeitgenössischer Journalismus?»
Mit etwas über 20 interessierten und altersmässig durchmischten Gästen hatten wir ein neugieriges und engagiertes Publikum. Nach einer spannenden Podiumsdiskussion mit unseren Special Guests konnten die Teilnehmenden ihre eigene Medienkompetenz in einem spielerischen Online-Quiz testen. Das Quiz beinhaltete Fragen rund um das Erkennen von KI-generierten Videos und Bildern – und generell von Fake News. Kathrin Häseli aus der Arbeitsgruppe Junge führte durch das Quiz und gab immer wieder Tipps und Tricks, die den Blick auf Nachrichten im Internet schärfen sollten.
Besonders erfreulich war der Besuch von zwei SRF-Gästinnen: Sina Alpiger von SRF Impact und Anik Leonhardt, Moderatorin bei Radio SRF Virus. Beide sind trotz ihres jungen Alters (29 und 27) bereits durch verschiedene Medienhäuser gegangen und bringen beeindruckende journalistische Erfahrungen mit. Auch Moderatorin Johanna Amann liess ihre Expertise aus ihrer Zeit beim Regionaljournal Aargau Solothurn einfliessen. Die Diskussion wurde ausserdem immer wieder durch Inputs aus dem Publikum bereichert. Als gefragt wurde, welche Nachrichtenquellen am häufigsten genutzt werden, entstand nach dem Scannen eines QR-Codes eine farbige Wordcloud auf der Leinwand hinter dem Podium: Von Internet über die SRF News-App, TikTok, Kassensturz bis hin zur klassischen und inzwischen weniger zeitgenössischen Zeitung war alles dabei. Noch spannender war jedoch die Frage, was dem Publikum beim Konsum journalistischer Inhalte wichtig ist. Die Antworten reichten von «aktuell» über «dass es stimmt», «dass es nicht fake ist», «klare Perspektive», «was ist die Message» bis zu «Katze» und «Pizza». Trotz der spielerischen Mischung kristallisierte sich ein klarer Anspruch heraus: Journalismus soll seine Aufgabe gut und glaubwürdig erfüllen. Und die vielen jugendsprachlichen Begriffe, die selbst ich als Gen-Z kaum mehr verstehe, zeigten deutlich, wie wichtig es ist, die Themen und Bedürfnisse junger Menschen im Journalismus sichtbar zu machen.
Dass KI und Social Media unsere Welt und insbesondere den Journalismus, stark verändert haben und weiterhin verändern werden, war unbestritten. Plattformen wie TikTok eröffnen neue Möglichkeiten, Nachrichten zu verbreiten, und prägen unsere Wahrnehmung von Journalismus tiefgreifend. Diese Entwicklung stellt das Selbstverständnis und den gesellschaftlichen Stellenwert des Journalismus infrage. Mulmige Gefühle sind da nur logisch. Doch eine Anekdote von Johanna brachte etwas Leichtigkeit in die Diskussion über die Zukunft des Journalismus und unserer Demokratie – in einer Zeit, in der Wahrheiten und Fakten gesellschaftlich neu ausgehandelt werden. Sie erzählte, die Angst vor dem Neuen sei nichts Neues: Schon die Erfindung der Schrift habe in der Antike Befürchtungen ausgelöst. Platon war überzeugt, das Verschriftlichen mache uns vergesslicher und schwäche unser Denkvermögen. Die Geschichte zeigt, dass es meist weniger schwarz-weiss kommt, als man befürchtet – und dass Offenheit gegenüber Veränderungen wohl einer der Schlüssel unserer Zeit ist. Journalismus wird auch künftig seinen Platz suchen müssen und hoffentlich finden.
Auch das Publikum durfte Fragen stellen. «Wie chani denn wüsse, was no echt isch, grad uf Insta, wo nume gfühlt 2 % vo dem stimmt, wo mer gseht?» Die Antwort: Guter, nachhaltiger Journalismus schafft Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit zeigt sich in Marken. Diese Logik lässt sich auch auf Social Media übertragen, allerdings braucht es eine gewisse Grundskepsis und Medienkompetenz, bis man seine vertrauenswürdigen Quellen gefunden hat. Fragen, die dabei helfen können: Wer arbeitet mit Quellenangaben? Lassen sich diese prüfen? Gab es früher grosse Fake-News-Skandale? Ist der Titel reisserisch? Was will die Botschaft bewirken? Und ganz grundsätzlich: Handelt es sich wirklich um journalistische Arbeit? Genau diese ist auch auf Social Media zentral, um die eben diese 2 % richtig zu machen und einen Ausgleich zu schaffen. Gerade für ein Publikum, das fast ausschliesslich auf solchen Plattformen bewegt.
Eine letzte, fast schon ironische Anekdote zum Schluss: Zur Vorbereitung baten wir die Gästinnen, uns Fälle mitzubringen, in denen sie oder ihre Redaktion selbst auf Fake News hereingefallen sind. Beide meldeten sich nach ein paar Tagen etwas verlegen zurück – sie hätten wirklich nichts gefunden, und auch das Brainstorming in den Redaktionen habe zu keinem Ergebnis geführt. Im Gruppenchat wurde das mit einem Augenzwinkern als #Qualitätsjournalismus abgesegnet.